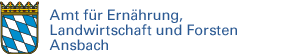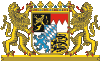Sortenempfehlungen Wintergerste Herbst 2025

Sortenversuchsfeld
Wintergerste wichtigstes Kraftfutter für die Tierhaltung
Wintergerste stellt in Mittelfranken nach Winterweizen die zweitwichtigste Getreideart dar und liefert zugleich den größten Teil des Kraftfutters für die tierische Veredelung. In Milchvieh haltenden Betrieben ist auch das Gerstenstroh zur Verfütterung und als Einstreu sehr begehrt.
Die für Mittelfranken relevanten Landessortenversuche zu Wintergerste stehen in Rudolzhofen und in Bieswang.
Der Versuch in Rudolzhofen (Uffenheimer Gau, Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim) konnte wegen später Ernte der Vorfrucht Silomais und aufgrund ungünstiger Witterung erst am 18.10.2024 pfluglos gesät werden. Der Bestand lief Ende Oktober gleichmäßig auf und bestockte im Lauf des milden Winters, den er ohne Frostschäden überstand.
Die extreme Trockenheit im Frühjahr verhinderte aber eine weitere Bestockung, so dass die Bestandesdichten am Ende weit unterdurchschnittlich waren. Aus dem gleichen Grund führte auch der in Stufe 2 zu Schossbeginn applizierte Wachstumsregler zu einer deutlichen Einkürzung, und der Krankheitsdruck blieb sehr gering. Als zum Beginn des Ährenschiebens in Stufe 2 eine breit wirksame Fungizid-Kombination eingesetzt wurde, konnten noch keine Blattkrankheiten bonitiert werden. Später traten jedoch in der unbehandelten Stufe 1 Mehltau, Zwergrost, Netzflecken und der Komplex aus nichtparasitären Blattverbräunungen/Ramularia auf, wobei nur letzterer nennenswerten Einfluss auf den Ertrag gewonnen haben dürfte. Lokale Gewitterniederschläge reichten in den dünnen Beständen für eine gute Einkörnung aus, die letztendlich zu einem sehr guten Ertragsergebnis führte. Klassisches Lager kam nicht vor.
Der Bestand wurde am 2.7.2025 geerntet. Die zweizeiligen Sorten lieferten dabei bereits in der unbehandelten Stufe 1 immerhin durchschnittlich 90,1 dt/ha und in der einmalig mit Wachstumsreglern und Fungiziden behandelten Stufe 2 im Durchschnitt sogar 98,7 dt/ha, womit der mehrjährige Ertragsdurchschnitt dieses Standortes um 8 dt/ha überschritten wurde. Auch die mehrzeiligen Sorten erreichten mit durchschnittlich 95,1 dt/ha in Stufe 1 und 100,6 dt/ha in Stufe 2 angesichts des mehrjährigen Ertragsdurchschnittes von 91,4 dt/ha ein weit überdurchschnittliches Ergebnis, welches auch vor dem Hintergrund einer aufgrund der Lage des Versuchsfeldes im „Roten Gebiet“ um 20 % reduzierten Stickstoffdüngung zu sehen ist.
Dank des relativ hohen Ertragszuwachses durch die höhere Intensität in Stufe 2 konnte hier der Mehraufwand gedeckt und noch ein Mehrerlös von 31 €/ha erzielt werden. Bei den mehrzeiligen Sorten genügte die nur mäßige Ertragssteigerung in Stufe 2 nicht, um die zusätzlichen Kosten zu decken, so dass hier ein Mindererlös von 32 €/ha entstand.
Auch am Standort Bieswang (auf dem Jura, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) wurde der Versuch erst am 18.10.2024 in ein gepflügtes, im Saathorizont fast zu feuchtes Saatbett nach Vorfrucht Winterweizen gesät. Der Bestand lief dennoch rasch auf, überstand den Winter ohne Auswinterungsschäden und wies im Frühjahr trotz verspäteter Aussaat und ungünstiger Saatbedingungen eine akzeptable Bestandesdichte auf.
Aufgrund des auch an diesem Standort sehr großen Niederschlagsdefizits während des gesamten Frühjahrs war der Krankheitsdruck sehr gering. Mehltau und Ramularia, im mehrzeiligen Sortiment zusätzlich noch Zwergrost, traten erst sehr spät in Erscheinung und hatten daher keinen großen Einfluss mehr auf den Ertrag. Daher war eine einmalige Behandlung mit Fungiziden in Stufe 2 kurz vor dem Grannenspitzen ausreichend. Sowohl bei der in Stufe 1 nur zum späten Termin, als auch bei der in Stufe 2 zweimalig erfolgten Wachstumsregler-Behandlung handelte es sich angesichts der recht kurzen Bestände eher um Versicherungsmaßnahmen. Klassisches Lager trat in beiden Stufen nicht auf.
Bei der Ernte am 10.7.2025 lieferten die zweizeiligen Sorten in Stufe 1 durchschnittlich 93,7 dt/ha und in Stufe 2 durchschnittlich 97,4 dt/ha und somit 1 dt/ha mehr als im mehrjährigen Durchschnitt. Die höhere Intensität in Stufe 2 war nicht rentabel; sie führte zu einem Mindererlös von 57 €/ha. Die statistische Verrechnung bei den mehrzeiligen Sorten ergab eine zu hohe Grenzdifferenz, sodass der Versuch nicht wertbar ist. Als Grundlage für die Sortenberatung dienen hier die Erträge aus dem Vorjahr sowie die überregionale Verrechnung.
Inzwischen liegen auch die aktualisierten Sorteneinstufungen vor.
Für Standorte, auf denen neben dem bodenbürtigen Gerstengelbmosaikvirus-Typ 1 auch der Typ 2 vorkommt (v. a. Gipskeupergebiet im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim), werden die zweizeiligen Sorten Valerie und Bonnovi und die mehrzeilige Sorte SU Midnight empfohlen.
Die empfohlenen Sorten im Überblick
Informationen der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL)