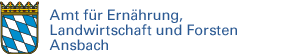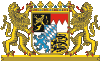Milchviehhaltertag 2025 - Rückblick
Faszinierende Erkenntnisse zur Verlängerung der Zwischenkalbezeit bei Milchkühen
Ökonomik und Fruchtbarkeit im Blick. Unter diesem Motto fand Ende Januar 2025 der Milchviehhaltertag des AELF Ansbach und der Verbände für landwirtschaftliche Fachbildung Ansbach, Dinkelsbühl und Rothenburg statt.
Vorgestellt und diskutiert wurden insbesondere die Themen Vermarktungsanforderungen, Modernisierung alter Laufställe, Verlängerung der Zwischenkalbezeit sowie Technik und Sensorik im Milchviehbetrieb. Lesen Sie im Rückblick mehr über die behandelten Themen und Erkenntnisse des Milchviehhaltertages.
Steigende Vermarktungsanforderungen bei positiven Vermarktungsaussichten
Steigende Vermarktungsanforderungen bei positiven Vermarktungsaussichten
Nachdem die Produktionskosten im Verhältnis zum Milchauszahlungspreisen weniger stark angestiegen sind ergibt sich für die letzten drei Jahre ein stärkerer Überhang auf der Erlösseite, was zu sehr positiven Entwicklungen bei den Milchkuh-Deckungsbeiträgen und den Gewinnen in Milchviehbetrieben führt. Bewegte sich beispielsweise in der Vergangenheit der Deckungsbeitrag II (nach variablen Grobfutterkosten) für die durchschnittliche bayerische konventionelle LKV-Fleckviehkuh bei 1.350-1.650 €/Kuh, so ist dieser in den letzten zwei Jahren auf rund 2.200 €/Kuh angestiegen. Am Beispiel einer Buchführungsauswertung über 10 Jahre von bayerischen Haupterwerbsbetriebe mir rund 50 Milchkühen verdeutlichte Bernhard Ippenberger ebenfalls die erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklungen.
Während in den Wirtschaftsjahren 2013/2014 bis 2021/2022 der Gewinn in der Regel zwischen 40.000-60.000 € (netto) pendelte, wurden im Wirtschaftsjahr 2022/2023 rund 90.000 € erzielt. Ein Betrag, der aus Sicht von Bernhard Ippenberger eigentlich auch die untere Schwelle für einen zukunftsfähigen, familiengeführten Haupterwerbsbetrieb darstellt. Bei den Auswertungen für den Gewinn im Wirtschaftsjahr 2023/2024 wird ein ähnliches Niveau erwartet.
Auch auf Vollkostenebene zeigt sich für das Auswertungsjahr 2022/2023 für die knapp 70 an der Betriebszweigauswertung (BZA) teilnehmenden bayerischen Betriebe mit einem kalkulatorischen Betriebszweigergebnis ("Unternehmergewinn") von 6,8 ct/kg ECM, ein in seiner Höhe noch nie erreichtes Ergebnis. Im 14-jährigen Durchschnitt fehlen 2,2 ct/kg ECM auf die Vollkostendeckung, trotz dem Überschuss im Auswertungsjahr 2022/2023. Bei der Berechnung der Produktionsvollkosten, werden neben den Kosten aus der Gewinn- und Verlustrechnung der Buchführung auch kalkulatorische Faktorkosten für die eigene Arbeit, für eigene Flächen und für das gebundene Kapital in Ansatz gebracht.
Für die Zukunft sieht Bernhard Ippenberger die Milchproduktion auf dem angehobenen Preis- und Kostenniveau der vergangenen drei Jahre. Mit ein Grund für diese Entwicklung dürfte der sich weiter fortsetzende Strukturwandel sein, welcher voraussichtlich trotz weiterer Leistungssteigerungen bei den Milchkühen zu einer Reduktion der verfügbaren Milchmenge führen wird. In Bayern reduzierte sich beispielsweise die Zahl der Milchviehhalter zwischen 1980 und 2023 von 175.000 auf 23.400, die Zahl der Milchkühe ging im gleichen Zeitraum von knapp 2 Mio. auf 1,06 Mio. zurück. Schreibt man den Strukturwandel der Vergangenheit bis 2040 fort, würde die Zahl der Milchviehhalter unter 11.000 und die Zahl an gehaltenen Milchkühen auf 0,83 Mio sinken.
Die für die Zukunft positiven Vermarktungsaussichten bei der Milch sind jedoch auch gepaart mit stetig steigenden Vermarktungsanforderungen von Seiten der Molkereien bzw. des Lebensmitteleinzelhandels. Zu solchen gestiegenen Vermarktungsanforderungen zählen beispielsweise die von vielen Molkereien mit Aufschlägen beim Milchauszahlungspreis versehenen Haltungsformen für mehr Tierwohl bei den Milchkühen oder die Betrachtung von Treibhausgas-Emissionen bei der Milchviehhaltung.
In Bezug auf die Einordnung des Tierwohls in verschiedene Haltungsstufen kommt im Bereich der Milchviehhaltung auf den Produkten in erster Linie das Logo von Haltungsform.de zum Zuge. Haltungsform.de ist eine Initiative der Privatwirtschaft unter deren Logos sich verschiedene am Markt bestehende Tierwohlsiegel einordnen und klassifizieren lassen. Die Haltungsformkennzeichnung erfolgt dabei mittlerweile, angepasst an die Fünfstufigkeit und die Bezeichnungen der staatlichen Tierhaltungskennzeichnung, in fünf statt nur wie früher, vier Haltungsformen. Die verpflichtende Ausweisung von Produkten mit dem staatlichen Tierwohllabel nach dem Tierhaltungskennzeichungsgesetz betrifft aktuell nur das Fleisch von Schweinen. Die verpflichtend vorgeschriebene Ausweisung von Produkten soll aber schrittweise auf weitere Tierarten ausgeweitet werden.
Ob über das staatliche Tierwohllabel oder das Label von Haltungsform.de gekennzeichnet, die Ausweisung von Produkten nach Haltungsstandards wird auch in Zukunft wohl zunehmen und eine weiterhin steigende Rolle bei der Vermarktung spielen. Dies zeigen auch die Äußerungen und Absichten von Lebensmitteleinzelhändlern, welche bei bestimmten Produktgruppen zukünftig nur noch Waren der Haltungsstufe 3 und höher anbieten möchten. Für den zukunftsorientierten Betrieb gilt es daher, sich mit den verändernden Vermarktungsanforderungen auseinanderzusetzen und wo ökonomisch sinnvoll oder aber auch gegebenenfalls notwendig, Anpassungsmaßnahmen für den eigenen Betrieb zu entwickeln.
Für die Anpassung der Milchproduktion an höhere Haltungsstufen, entstehen für die Betriebe auf unterschiedlichen Ebenen Kosten. Beispielsweise durch den höheren Platzbedarf der Tiere und durch bauliche Anpassungen. Darüber hinaus fallen Kosten für Weiterbildungsmaßnahmen und umfangreiche Bestandsbetreuung auch durch den Tierarzt an. Die geforderten Maßnahmen zum Gesundheitsmonitoring verursachen Arbeitszeit bei Landwirt und Tierarzt.
Wie hoch die Kosten für eine bauliche Anpassung an die höheren Haltungsstufen drei und vier ausfallen, hängt stark vom Alter und von der baulichen Ausführung des vorhandenen Stalls und der Bestandsgröße ab. Bernhard Ippenberger zeigte anhand von verschiedenen Beispielkalkulationen die Größenordnung der Kosten für die Anpassungsmaßnahmen auf. Für einen 15 Jahre alten Laufstall für 60 Milchkühe, der noch nicht das Kriterium "Offenfrontstall" erfüllt, ergaben sich dabei Anpassungskosten von ca. 4-6 ct/kg Milch für Haltungsstufe drei und ca. 8-10 ct/kg für Haltungsstufe vier. Für einen neuen Offenfront-Stall mit 80 Kühe bezifferte Bernhard Ippenberger die Anpassungskosten für Haltungsstufe vier mit rund 2-3 ct/kg Milch. Je nach gezahltem Aufschlag von Seiten der Molkereien können damit bei relativ neuen Ställen teils lukrative Zusatzeinnahmen generiert werden.
Auch das Thema Treibhausgasreduzierung wird in der Tierhaltung aufgrund der politischen Vorgaben zur Reduktion der Treibhausgasemissionen auch im Bereich Landwirtschaft weiterhin eine Rolle spielen. Hierzu gibt es auch heute schon Molkereien, welche die Klimawirkung der Milchproduktion bei ihren Milcherzeugern bewerten und Zuschläge für Milch aus Betrieben mit einem möglichst geringen CO2-Fußabdruck auszahlen. Positiv für die Betriebe ist, dass die Verringerung der Treibhausgas-Emissionen meist auch wirtschaftlich gewinnbringend ist! Denn für die Reduktion der Treibhausgase sind insbesondere die Stellschrauben Futterbau, Fütterung, Erstkalbealter und Nutzungsdauer der Tiere sehr wichtig.
Zum Abschluss des Vortrages beantwortete Bernhard Ippenberger die zu Beginn gestellte Frage, welche Betriebe zukünftig noch mitspielen in der Milchproduktion mit den nachfolgenden Punkten. Dabei wird klar, dass es auch weiterhin auf die betriebsindividuellen Produktionsvoraussetzungen und auf die Leidenschaft zur Kuh ankommen wird um erfolgreich Milch zu produzieren.
Jede/jeder, der
- eine entsprechende Faktorausstattung vorweisen kann,
- einen geeigneten Standort hat,
- gut ausgebildet ist,
- in der MIlchviehhaltung mehr als einen "Job" sieht,
- gut mit sich schnell ändernden Rahmenbedingungen klar kommt,
- offen ist für neue Entwicklungen und bestehende Herausforderungen annimmt,
- auch den Blick von außen auf seinen Betrieb kennt,
- über die Größe die Kostendegression nutzen kann,
- als kleinerer Betrieb Zusatzeinkommen generieren kann das wenig Arbeit macht und seine Produkte gut vermarkten kann.
Weitere Informationen zu betriebswirtschaftlichen Auswertungen
- Milchmarkt aktuell - Monatsstatistiken - LfL

- Buchführungsauswertung der spezialisierten Milchviehbetriebe in Bayern - LfL

- Milchreporte Bayern - LfL

- Tierwohl in der Milchproduktion - LfL

- Haltungsform.de

- Staatliche Tierhaltungskennzeichnung - Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

- Kalkulationsprogramm Klima-Check Landwirtschaft - LfL

Tierwohl baulich umsetzen
Tierwohl baulich umsetzen
Passend zu den Ausführungen von Bernhard Ippenberger zu den gestiegenen Anforderungen im Bereich der Haltungsbedingungen durch die Kennzeichnung von Produkten nach Haltungsformen stellte Christian Blank vom AELF Ansbach an einem ausgewähltem Beratungsfall verschiedene Möglichkeiten zur baulichen Umsetzung von mehr Tierwohl bei älteren Milchviehlaufställen vor. Christian Blank ist der Nachfolger von Jörg Rupp und als staatlicher Bauberater für ganz Mittelfranken zuständig. Die Modernisierung von bestehenden Milchviehlaufställen stellt in der Beratung aus verschiedenen Aspekten vermehrt ein Thema dar. Zum einen im Zusammenhang mit der Adaption der Haltungsbedingungen an die Vorgaben der Haltungsformen, um bei den Molkereien einen Aufschlag beim Milchpreis realisieren zu können. Zum anderen aber auch, um aus eigenem Interesse heraus was für das Tierwohl bei den Kühen zu tun. Gerade bei den ersten Laufställen aus den 80ern und 90ern besteht bei den Platzverhältnissen sowie bei der Belichtung und Belüftung oft großes Optimierungspotential.
Für die Entwicklung von Umbau- und Modernisierungslösungen benötigt es zunächst eine Grundlagenermittlung in Bezug auf die Bestandsgebäude und den Standort. Folgende Punkte sind hierbei zu betrachten:
- Bestandsgebäude:
- Ermittlung der Geometrie durch Pläne oder messen.
- Zustand der Bausubstanz erfassen.
- Wie sieht die tragende und aussteifende Konstruktion des Stalles aus (Stützen, Rahmen- oder Massivgebäude)?
- Standort:
- Ist eine bauliche Erweiterung oder eine Erhöhung der Tierzahlen hinsichtlich der Geruchsabstände möglich?
- Können angrenzende Gebäude integriert werden?
- Ist eine spätere Erweiterung möglich?
- Wie sieht die umgebende Geländeform aus (Abgrabungen, Auffüllungen, Abfangungen,…)
- Wie groß sind die Abstände zu Straßen?
- Wie groß sind die Abstände zu Fließgewässern?
In vielen Fällen kann es aber gelingen Modernisierungsmaßnahmen bei den vorhandenen Ställen umzusetzen. Dies reicht von kleineren Maßnahmen wie beispielsweise das Öffnen von Seitenwänden bei den Stallungen, um einen besseren Luftaustausch oder auch mehr Platz für den Kopfbereich von wandständigen Liegeboxen in den Stallungen zu schaffen. Größere Maßnahmen gehen dann in der Regel mit Stallerweiterungen, beispielsweise durch den Anbau von Fressbereichen mit integrierten Ausläufen oder durch Außenliegeboxenreihen mit integrierten Ausläufen einher. Damit können aber auch im vorhandenen Gebäude größere Anpassungen bei den Bereichen Fressen, Laufen und Liegen verbunden sein. So z.B. auch die Umwandlung eines Stalls mit drei Liegeboxenreihen zu zwei Liegeboxenreihen um für die Milchkühe mehr Platz in den Liegeboxen und auf den Laufgängen zu erreichen.
Auch der Ersatz des klassischen Futtertisches durch den Einbau eines Futterbandes kann eine Option sein um Platz für Umbaumaßnahmen zu gewinnen und den Nutzbaren Bereich für die Milchkühe zu vergrößern. Diese und weitere bauliche Modernisierungsmaßnahmen, welche auch den Kälber- und Jungviehbereich mit beinhalten wurden von Christian Blank vorgestellt, um Ideen und und Inspiration für Modernisierungslösungen auf den eigenen Betrieben der Teilnehmer zu geben. Deutlich wurde, dass es sich immer um sehr individuelle Lösungen handelt, da die Ausgangssituation auf den Betrieben sehr unterschiedlich ist. Dabei sollte bei den Betrachtungen nicht nur die bauliche Umsetzbarkeit sondern auch die ökonomische Umsetzbarkeit betrachtet werden. Das AELF Ansbach bietet hierzu Unterstützung für interessierte Betriebe.
Weitere Informationen zum Thema Bauen:
Strategische Verlängerung der Zwischenkalbezeit
Strategische Verlängerung der Zwischenkalbezeit
"Jeder Tag verlängerte Zwischenkalbezeit kostet 3,5 €" und "Zwischenkalbezeiten über 400 Tage sind unökonomisch." Mit diesen beiden Aussagen aus bereits älteren Untersuchungen begründete Dr. Christian Fidelak die bisher vermeintlich passenden Empfehlungen zur Zwischenkalbezeit. Doch gelten diese Empfehlungen vor dem Hintergrund der gestiegenen Milchleistungen auf ein Niveau von über 12.000 kg bei Schwarzbuntkühen oder auch über 10.000 kg bei Fleckviehkühen, wie es von Spitzenbetrieben erreicht wird, auch immer noch für die Fruchtbarkeit? Dieser Frage ging Dr. Christian Fidelak, der Geschäftsführer der bovicare GmbH ist und als Projektpartner über das Institut für Fortpflanzung landwirtschaftlicher Nutztiere (IFN) Schönow e.V. im Projekt "VerLak" (Verlängerung der Laktationsperiode und selektives Trockenstellen zur Minimierung des Antibiotikaeinsatzes bei Milchkühen) mitgearbeitet hat, in seinem Vortrag am Nachmittag nach.
Was versteht man unter einer strategischen Verlängerung der Zwischenkalbezeit?
Unter einer strategischen Verlängerung der Zwischenkalbezeit bzw. der Laktation versteht man ein späteres Besamen der Kühe nach der Kalbung als bislang üblich. Der Betrieb entscheidet dabei selbst, wie viel freiwillige Wartezeit er der Kuh gewährt. Die Entscheidung, wann eine Kuh besamt wird dabei bewusst anhand von verschiedenen Kriterien wie Laktionstag, Milchmenge, Körperkondition, Vorgeschichte und damit im Regelfall kuhindividuell entschieden. Ab 80 Tagen freiwillige Wartezeit und Zwischenkalbezeiten von über 400 Tagen kann von einer verlängerten Zwischenkalbezeit gesprochen werden. Eine Verlängerung der Zwischenkalbezeit aufgrund von Fruchtbarkeitsproblemen ist damit aber nicht gemeint!
- Verbesserung der Fruchtbarkeitskennzahlen bei Kühen mit hohen Leistungen über 10.000 kg. Je länger hier die Rastzeit wird, desto niedriger wir der Besamungsaufwand und die Verzögerungszeit
- Jede Kalbung stellt ein Gesundheitsrisiko dar. Durch die Verlängerung der Zwischenkalbezeit reduziert sich der Anteil an kritischen Phasen um die Geburt. Die Erkrankungsrisiko für z.B. Stoffwechselerkrankungen sinkt und Tierarztkosten können gesenkt werden.
- Niedrigere Milchmengen zum Trockenstellen verringern die Gefahr von Eutererkrankungen und helfen den Antibiotikaeinsatz zu reduzieren.
- Eine spätere Besamung hat auch Einfluss auf die Persistenz der Milchkühe in der Laktation, welche sich durch eine längere freiwillige Wartezeit erhöhen kann
- Eine längere Zwischenkalbezeit hat positive Auswirkungen auf die Nutzungsdauer und die Lebens- und Lebenstagsleistung der Milchkühe
- Reduktion der Arbeitsbelastung, da weniger Abkalbekühe und Kälber
In der Betrachtung Zwischenkalbezeiten über alle Kühe der teilnehmenden Praxisbetriebe ergab sich ein Unterschied von 47 Tagen zwischen den Versuchsgruppen. Während die Kontrollgruppe auf durchschnittlich 354 Tage Zwischenkalbezeit kam, erreichte die Versuchsgruppe eine Zwischenkalbezeit von im Durchschnitt 401 Tagen. Die Unterschiede in der Zwischenkalbezeit fallen damit noch erstaunlich moderat aus.
- Milchleistung einzelner Kühe von über 9.000 kg
- gutes Fruchtbarkeitsmanagement
- keine fetten Kühe zu Laktationsende
- kein Bedarf an vielen Kälbern/Nachzucht
- Lust am Ausprobieren
Markus Deffner bewirtschaftet mit seiner Familie einen landwirtschaftlichen Betrieb mit rund 65 Fleckviehkühen und der weiblichen Nachzucht. Zudem ist der Betrieb im Bereich Erneuerbare Energien diversifiziert. Markus Deffner hat vor rund vier Jahren damit begonnen, die Zwischenkalbezeit bei seinen Fleckviehkühen bewusst zu erhöhen.
Folgende Ziele standen dabei für Markus Deffner im Vordergrund:
- Stabilere/gesündere Kühe
- Weniger Abkalbungen
- länger bessere Euter
- Tierarztkosten senken
- mehr abgelieferte Milch je Tier
- Arbeitszeitbedarf senken
- Geringere Belegungsdichte im Jungviehbereich
Weitere Informationen zum Thema verlängerte Zwischenkalbezeit:
Technik und Sensorik zur Erleichterung der Stallarbeit
Technik und Sensorik zur Erleichterung der Stallarbeit
Fazit zur bisherigen Automation und Sensortechnik auf dem Betrieb Wirsching:
- Technik erleichtert den Arbeitsalltag und kann Arbeitsabläufe ersetzen.
- Die Arbeitszeitersparnis je Maschine ist schwer abzuschätzen, da oft auch andere Bereiche mit betroffen sind (Beispiel Spaltenschieberoboter und Klauengesundheit).
- Vor einer Investition sollte das eigene Interesse hinterfragt werden und die Probleme im Betriebsablauf identifiziert werden. Jeder Betrieb ist anders!
- Ein störungsfreier Betrieb ist nur bei regelmäßiger Wartung möglich.
Ansprechpartner
AELF Ansbach
Mariusstraße 26
91522 Ansbach
Telefon: 0981 8908-1234
Fax: 0981 8908-1026
E-Mail: poststelle@aelf-an.bayern.de