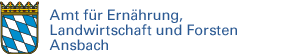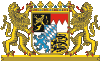Sortenempfehlungen Winterweizen, Winterdinkel und Winterdurum Herbst 2025

Landessortenversuch Greimersdorf
Winterweichweizen nach wie vor wichtigste Weizenart
Verglichen mit dem klassischen Winterweichweizen spielen Winterdinkel und insbesondere der für die Nudelherstellung verwendete Winterdurum in Mittelfranken nur eine sehr untergeordnete Rolle. Der Winterweichweizen aber stellt die wichtigste Getreideart und nach Silomais die zweitwichtigste Feldfrucht überhaupt dar.
Winterweizen:
Die für Mittelfranken relevanten Landessortenversuche zu Winterweizen stehen in Greimersdorf und in Bieswang.
Nach Vorfrucht Silomais erfolgte am Standort Greimersdorf (trockene Keuperlage bei Cadolzburg, Landkreis Fürth) die Aussaat am 21.10.2024 pfluglos. Der Versuch lief im feuchten Herbst sehr zügig und gleichmäßig auf, entwickelte sich dann aber eher zögerlich weiter und überstand den Winter schadlos. Kalte Nächte verzögerten im Frühjahr das Anspringen der Vegetation; die dann folgende große Trockenheit bis in den Frühsommer sorgte für eine nur schwache Bestockung, so dass der Bestand eine unterdurchschnittliche Bestandesdichte aufwies. Diese Witterung senkte jedoch auch den Krankheitsdruck sehr nachhaltig, weshalb die einmalige Fungizidmaßnahme in Stufe 2 bis zum Stadium der Vollblüte hinausgeschoben werden konnte. Doch selbst zu diesem späten Zeitpunkt waren noch keine Blattkrankheiten zu bonitieren. Nur einzelne Sorten zeigten nichtparasitäre Blattflecken in größerem Umfang. Erst nach der Blüte trat in der unbehandelten Stufe 1 noch vereinzelt Braunrost auf. Lager entstand nicht, so dass die in Stufe 2 einmalig durchgeführte Behandlung mit einem Wachstumsregler eher eine Versicherungsmaßnahme darstellte. Die Abreife verlief im trocken-heißen Juni sehr rasch.
Der Versuch wurde am 19.7.2025 geerntet. Der nur sehr geringe Ertragsunterschied zwischen der unbehandelten Stufe 1 (66,9 dt/ha) und der jeweils einmal mit Wachstumsreglern und Fungiziden behandelten Stufe 2 (68,6 dt/ha) erklärt sich mit dem quasi nicht vorhandenen Krankheits- und Lagerdruck und reichte nicht aus, um die zusätzlichen Kosten zu decken. Es entstand ein Mindererlös von 60 €/ha. Das zwar schlechte, angesichts der extremen Trockenheit aber nachvollziehbare Ergebnis verfehlte den langjährigen Mittelwert dieses für Mittelfranken recht typischen Standortes um 11 dt/ha.
Am Standort Bieswang (auf dem Jura, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) wurden leichte Bodenunterschiede offenbar durch die extreme Trockenheit derart verstärkt, dass letztendlich sehr große, fachlich kaum erklärbare Unterschiede zwischen den Behandlungsstufen und den Wiederholungen auftraten. Der Versuch war zwar „mit Hängen und Würgen“ statistisch wertbar, fachlich ist er es aber nicht. Als Grundlage für die Sortenberatung dienen ersatzweise die Ergebnisse des Standortes Hartenhof (Landkreis Neumarkt).
Am Standort Schwabsroth (mittlere Keuperlage bei Geslau, Landkreis Ansbach) werden Winterweizensorten auf ihre Fusariumanfälligkeit geprüft. Um eine Fusariuminfektion zu provozieren, werden im Herbst Maisstoppeln in die gesäten Parzellen eingestreut. Die auftretenden Blattkrankheiten, wie z. B. Gelbrost und Septoria tritici, sind mit einer Fungizidmaßnahme zu bekämpfen, und zwar spätestens, wenn das Fahnenblatt voll geschoben ist (EC 39). Anschließend erfolgt keine Fungizidmaßnahme mehr, um die Sortenanfälligkeit für Ährenfusarium ohne Fungizideffekt beurteilen zu können.
Der Versuch wurde am 22.10.2024 nach Vorfrucht Silomais in ein gepflügtes Saatbett gesät, lief dank des feucht-milden Herbstwetters rasch auf und zeigte eine normale Vorwinterentwicklung. Angesichts des trockenen Frühjahrs und Frühsommers verlief die weitere Entwicklung überraschend gut; jedoch führte eine etwas verringerte Bestockung zu einer leicht unterdurchschnittlichen Bestandesdichte. Der Krankheitsdruck blieb auf sehr niedrigem Niveau. Zum Zeitpunkt der einmaligen Fungizidmaßnahme, als das Fahnenblatt spitzte (EC 37), konnten keine Blattkrankheiten bonitiert werden. Die Blüte setzte um den 3. Juni ein. An den ersten Tagen der Blühphase fielen am Versuchsstandort noch ein paar Regenschauer von 2 bis 5 mm bei Tageshöchsttemperaturen von rund 20 °C. Ab dem 9. Juni blieb es komplett niederschlagsfrei. Die Bedingungen für Fusarium-Infektionen waren damit grenzwertig. Bei der Bonitur am 23. Juni war nur an einigen als anfällig bekannten Sorten mäßiger Befall mit Ährenfusarium zu erkennen. Die Abreife verlief wegen der Hitze und der Trockenheit im Juni sehr rasch. Im Juli einsetzende Niederschläge verzögerten die Ernte jedoch.
Bei der Ernte am 8.8.2025 wurde ein Durchschnittsertrag von 72,0 dt/ha erreicht. Trotz zumindest ansatzweise gegebener Infektionsbedingungen und teilweise optisch erkennbarem Ährenbefall ergab die Untersuchung von Ernteproben auf Deoxynivalenol (DON), dem von Fusarium produzierten Mykotoxin, lediglich bei einer als hoch anfällig bekannten Sorte einen Gehalt deutlich oberhalb der Nachweisgrenze. Doch ein Blick auf die Ergebnisse früherer Jahre sollte dazu animieren, die Sortenanfälligkeit bei Fusarium stets im Blick zu behalten, um den Vorgaben des „Integrierten Pflanzenbaus“ Rechnung zu tragen. Da aus den genannten Gründen heuer kein Einfluss von Ährenfusarium auf den Ertrag zu befürchten ist, können die Erträge gleichwertig mit den anderen Versuchsstandorten als Basis für die Sortenempfehlungen herangezogen werden.
Folgende Sorten werden zum Anbau in Mittelfranken empfohlen:
E-Sorten:
Axioma (Secobra)
Axioma verfehlt als ausgesprochene Qualitäts-Sorte regelmäßig deutlich den Ertragsdurchschnitt des Sortiments. Die recht Fallzahl-stabile Sorte zeichnet sich durch Bestnoten in Proteingehalt, Sedimentationswert und Backvolumen aus. Sie hat gute bis sehr gute Resistenzen gegen Mehltau, Gelbrost und Fusarium und gut durchschnittliche gegen Septoria tritici und Braunrost. Axioma ist überdurchschnittlich standfest. Aufgrund seiner sehr guten Qualität sollte ein höherer Preis vertraglich abgesichert werden. Beim Einsatz CTU-(Chlortoluron-)haltiger Herbizide (z. B. Lentipur, Carmina) ist die Wirkstoffmenge auf maximal 900 g/ha zu begrenzen.
KWS Emerick (KWS)
Die Sorte liegt ertraglich meist nur knapp unter dem Durchschnitt des gesamten Sortimentes, was für einen E-Weizen eine sehr gute Leistung darstellt. An den lokalen Versuchsstandorten schnitt sie heuer sogar deutlich besser ab als überregional. Sie kann nicht ganz mit den älteren A-Sorten mithalten, liefert aber deutlich höhere Rohproteingehalte. KWS Emerick ist bei den meisten Blattkrankheiten sowie bei Fusarium überdurchschnittlich, bei Gelbrost sogar gut bis sehr gut, bei Septoria tritici aber nur durchschnittlich eingestuft. Er ist winterhart und gut standfest. Die Sorte gilt als ertragreicher Elite-Weizen mit oft nur knapper E-Qualität, der meist als guter A-Weizen recht sicher zu vermarkten ist. Der gemäß Düngeverordnung um 30 kg/ha höhere N-Bedarfswert im Vergleich zu den A-Sorten mag für manchen Landwirt ein Grund für die Wahl dieses Sortentyps sein.
Exsal (DSV)
Die begrannte Sorte gilt als Ergänzung zu KWS Emerick mit sehr ähnlichem Ertrags- und Resistenzniveau. Mit seiner nur durchschnittlichen Einstufung beim Rohproteingehalt gilt Exsal aber nicht als „klassischer“ Elite-Weizen und wird in der Praxis nur schwerlich E-Qualität erreichen. Dank des bei E-Sorten gewährten Zuschlages von 30 kg N/ha in der Düngebedarfsermittlung ist jedoch unter günstigen Bedingungen zumindest eine A-Qualität erzielbar. Exsal weist eine nur unterdurchschnittliche Winterhärte, aber eine gute Standfestigkeit auf. Er ist resistent gegen die Orangerote Weizengallmücke, die vor allem in Stoppelweizen relevant sein kann. Wenngleich begrannte Sorten oft hauptsächlich in Gebieten mit hohem Wildschwein-Aufkommen verwendet werden, spricht auch nichts gegen einen Anbau in davon nicht betroffenen Regionen.
A-Sorten:
Asory (Secobra)
Asory liefert überregional und auch mehrjährig nur noch knapp durchschnittliche Kornerträge, schnitt an den lokalen Versuchsstandorten Greimersdorf und Hartenhof heuer aber erneut deutlich besser ab. Trotz seiner schlechten Einstufung beim Rohproteingehalt hat er sehr gute Backeigenschaften, was auch als „hohe Rohprotein-Effizienz“ beschrieben wird. Er ist nur knapp durchschnittlich standfest, stärker anfällig für DTR und nur durchschnittlich resistent gegen Septoria tritici und Gelbrost. In den übrigen Blattkrankheiten und bei Fusarium ist er überdurchschnittlich eingestuft. Er zeigt eine mittlere bis gute Winterhärte und eine schlechte Fallzahlstabilität. Letztere wird vor allem in Erntejahren wie 2025 relevant, wenn sich die Ernte wegen einer längeren Regenphase verzögert.
SU Jonte (R2n/Saaten-Union)
SU Jonte brach im trockenen Jahr 2025 sowohl lokal als auch überregional ertraglich deutlich ein, nachdem er dank seiner guten Blattgesundheit im feuchten Jahr 2024 punkten konnte. Mehrjährig erreicht er nicht mehr den Durchschnitt des Sortiments. Der Rohproteingehalt ist durchschnittlich, die Standfestigkeit wie auch die Winterhärte sind leicht überdurchschnittlich. SU Jonte ist gegen alle relevanten Krankheiten, inklusive Fusarium, gut durchschnittlich resistent. Auch ein Anbau als Stoppelweizen ist möglich.
LG Optimist (Limagrain)
Die Sorte rangiert heuer erneut sowohl an den regionalen Versuchsstandorten als auch überregional und vor allem mehrjährig mit an der Spitze der geprüften A-Sorten. Im Rohproteingehalt ist LG Optimist jedoch nur unterdurchschnittlich eingestuft und weist eine Schwäche in der Standfestigkeit auf. Er zeigte sich gut winterhart. Bei den Resistenzen gegen Blattkrankheiten fällt insbesondere die gute bis sehr gute Einstufung bei Gelb- und Braunrost auf. Auch gegen Fusarium ist LG Optimist gut durchschnittlich resistent. Er kann auch als Stoppelweizen angebaut werden.
SU Magnetron (Nordsaat/Saaten-Union)
Ertraglich schnitt die Sorte heuer sowohl an den regionalen Versuchsstandorten Greimersdorf und Hartenhof als auch überregional in den zugehörigen Anbaugebieten „Fränkische Platten“ (AG 21) und „Jura/Hügelland“ (AG 23) noch etwas schwächer ab als im Vorjahr. Lediglich am Standort Schwabsroth lag sie über dem Durchschnitt des Sortiments. Ihre Stärke ist jedoch nicht der Ertrag, sondern der Rohproteingehalt, bei dem sie mit deutlichem Abstand an der Spitze der empfohlenen A-Weizensorten und auch über den empfohlenen, ertragsstarken E-Weizensorten liegt. Außerdem ist die Sorte frühreif, sehr standfest und überdurchschnittlich blattgesund. Weniger erfreulich sind die nur durchschnittliche Resistenz gegen Fusarium und die deutlich unterdurchschnittliche Fallzahlstabilität. SU Magnetron ist resistent gegen die Orangerote Weizengallmücke. Die Anbauempfehlung gilt für beide Anbaugebiete. Als Saatstärke empfiehlt der Züchter 280-400 Körner/m².
Ambientus (Secobra)
Ambientus ist der zweite A-Weizen, der in beiden Anbaugebieten neu in der Empfehlung steht. Er liegt auf einem etwas höheren Ertragsniveau als SU Magnetron, jedoch immer noch unter dem Durchschnitt des Sortiments. Auffällig sind die meist besseren Ergebnisse in der Fungizid-freien Stufe 1, worin sich die gute Blattgesundheit, insbesondere bei Braunrost, widerspiegelt. Die Einstufung beim Rohproteingehalt liegt um eine Note unter jener von SU Magnetron und damit immer noch über allen anderen geprüften Sorten dieser Qualitätsgruppe. Ambientus ist weniger anfällig für Fusarium, durchschnittlich standfest und recht Fallzahl-stabil. Der Züchter empfiehlt als Saatstärke 230-380 Körner/m².
Akzent (Breun/Limagrain)
Die Sorte zeigte sich heuer am Versuchsstandort Hartenhof wiederholt ertraglich deutlich überdurchschnittlich. Am Standort Greimersdorf konnte sie die sehr guten Ergebnisse der Vorjahre nicht wiederholen. Überregional und auch mehrjährig liegt sie aber nach wie vor im Durchschnitt des Sortiments. Akzent liefert nur unterdurchschnittliche Rohproteingehalte und ist – abgesehen von Braunrost – recht blattgesund. Bei Fusarium besitzt er eine gute und somit die beste Einstufung unter den empfohlenen A-Sorten und passt daher auch gut in Mais-Fruchtfolgen. Ebenso ist Akzent für den Anbau als Stoppelweizen geeignet.
B-Sorten:
KWS Mintum (KWS)
KWS Mintum erzielte heuer an den regionalen Versuchsstandorten sehr gute Kornerträge, nach eher enttäuschenden Ergebnissen im Vorjahr. Überregional und auch mehrjährig übertrifft er den Durchschnitt des Sortiments nur leicht, was für einen B-Weizen nicht befriedigend ist. Die Einstufung beim Rohproteingehalt ist typisch für diese Qualitätsstufe. KWS Mintum ist – außer bei Braunrost – gegen alle wichtigen Blattkrankheiten und auch gegen Fusarium überdurchschnittlich resistent. Zu beachten ist jedoch die schlechte Fallzahlstabilität. Der Züchter bewirbt die Sorte explizit als spätsaatverträglich.
Chevignon (Hauptsaaten)
Chevignon brach im vorigen Jahr am Versuchsstandort Greimersdorf ertraglich deutlich ein, schnitt heuer aber dort und auch am Standort Schwabsroth wieder sehr gut ab. Überregional und mehrjährig bringt er nach wie vor weit überdurchschnittliche Erträge. Er ist frühreif. Zu beachten ist die leicht unterdurchschnittliche Einstufung bei der Standfestigkeit. Größtes Manko der durchschnittlich winterharten Sorte ist die durchschnittliche Anfälligkeit für Fusarium bei von Jahr zu Jahr stärker schwankenden DON-Gehalten, weshalb der Anbau nur im Anbaugebiet „Fränkische Platten“ (AG 21) und auch dort nur auf Standorten mit geringem Fusarium-Risiko empfohlen wird. Nach Vorfrucht Mais sollte daher eine saubere Pflugfurche erfolgen oder auf eine andere Sorte ausgewichen werden.
C-Sorten:
KWS Keitum (KWS)
Die Sorte steht an fast allen Orten und in allen Jahren ertraglich mit an der Spitze des Sortiments. Nachteilig sind die schlechte Standfestigkeit und die nur durchschnittliche Resistenz gegen Fusarium. Letztere schränkt sowohl ihre an sich gegebene Eignung als Brauweizen als auch jene für den pfluglosen Anbau nach Mais ein. KWS Keitum ist blattgesund und hat eine Resistenz gegen die Orangerote Weizengallmücke. Seine Winterhärte ist nur knapp durchschnittlich. Er ist auch für den Anbau als Stoppelweizen geeignet.
SU Shamal (Nordsaat/Saaten-Union)
SU Shamal liefert überregional und auch mehrjährig Erträge auf dem Niveau der bisherigen Standardsorte KWS-Keitum. Zu beachten ist die nur unterdurchschnittliche Standfestigkeit. Die Sorte ist frühreif, überdurchschnittlich resistent gegen Fusarium und hat eine Resistenz gegen die Orangerote Weizengallmücke. Sie steht in beiden Anbaugebieten neu in der Empfehlung. Als Saatstärke empfiehlt der Züchter 270-370 Körner/m².
Sortenspezifische Anbauhinweise (z. B. zur Saatstärke) zu den schon länger empfohlenen Winterweizen-Sorten stehen im aktuellen Versuchsberichtsheft „Integrierter Pflanzenbau“ („Grünes Heft“) auf den Seiten 70 und 71.
Weitergehende Informationen zu den empfohlenen Winterweizen-Sorten 2025 finden Sie hier  52 KB
52 KB
Die ausführlichen Versuchsergebnisse aus den Landessortenversuchen, die Sortenbeschreibung sowie weitere Informationen finden Sie bei der LfL:
Winterdinkel
Grundlage der Empfehlungen sind die LSV-Ergebnisse der Versuchsstandorte Schraudenbach (nördliche Fränkische Platte bei Werneck, Landkreis Schweinfurt) und Frankendorf (Landkreis Erding).
Folgende Sorten werden zum Anbau in Mittelfranken empfohlen:
Albertino (Alter)
Die Sorte zeigt an beiden Versuchsstandorten deutliche Ertragsschwankungen von Jahr zu Jahr, liegt aber sowohl ein- als auch mehrjährig in den süddeutschen Anbaugebieten leicht über dem Durchschnitt des Sortiments. Zu beachten sind die erhöhte Anfälligkeit für Mehltau und Braunrost sowie die nur knapp durchschnittliche Standfestigkeit. Bei den Qualitätseigenschaften ist besonders die hohe Mehlausbeute hervorzuheben.
Zollernfit (Südwestdeutsche Saatzucht/Saaten-Union)
Die Sorte liegt am Standort Schraudenbach ertraglich erneut im Mittel des Sortiments, verfehlte am Standort Frankendorf jedoch ihr sehr gutes Vorjahresergebnis deutlich. Überregional und mehrjährig liefert sie nur noch knapp durchschnittliche Erträge. Zollernfit bietet überdurchschnittliche Qualitäten und ist gut entspelzbar. Positiv sind die gute Resistenz gegen Gelbrost und die gute Standfestigkeit zu sehen. Die Sorte ist etwas anfälliger für Septoria tritici.
Franckentop (Franck/IG Pflanzenzucht)
Die heuer neu empfohlene Sorte konnte beim Kornertrag zwar weder an den regionalen Versuchsstandorten noch überregional oder mehrjährig ganz mit den bisher empfohlenen Sorten mithalten, stellt jedoch qualitativ eine wertvolle Bereicherung des Sortiments dar: So ist die Tausendkernmasse gut durchschnittlich, die Kern- und die Mehlausbeute jeweils gut und die Fallzahl sehr gut eingestuft. Die Sorte ist sehr gut entspelzbar, gut durchschnittlich standfest und weist eine erhöhte Anfälligkeit für Mehltau auf. Dafür ist sie gut bis sehr gut resistent gegen Gelbrost.
Weitergehende Informationen zu den empfohlenen Winterdinkel-Sorten 2025 finden Sie hier  24 KB
24 KB
Die ausführlichen Versuchsergebnisse aus den Landessortenversuchen, die Sortenbeschreibung sowie weitere Informationen finden Sie bei der LfL:
Winterdurum:
Grundlage der Empfehlungen sind die Versuchs-Ergebnisse des Standortes Giebelstadt (Gunstlage im Würzburger Gau, Landkreis Würzburg).
Die ein- und mehrjährigen Verrechnungen über das Anbaugebiet „Süd-West“ liegen noch nicht vor; daher sind hierfür aktuell nur die Daten aus dem Vorjahr verfügbar.
Folgende Sorten werden zum Anbau in Mittelfranken empfohlen, wobei generell nur mittlere bis gute Böden (Gau-Randlangen) in Frage kommen und Mais oder Weizen als Vorfrüchte ungeeignet sind:
Wintergold (Südwestdeutsche Saatzucht/Saaten-Union)
Die einstige Standard-Sorte lag in den letzten Jahren bei den Erträgen sowohl am Standort Giebelstadt als auch im Anbaugebiet „Süd-West“ meist leicht unter dem Durchschnitt des Sortimentes, brachte im Vorjahr ein überraschend gutes Ergebnis und fiel heuer wieder deutlich ab. Wintergold ist bei den Qualitätsmerkmalen, insbesondere der Glasigkeit, durchwegs gut eingestuft. Die Standfestigkeit sowie die Resistenzen gegen Gelbrost und Fusarium sind leicht überdurchschnittlich, jene gegen Mehltau und Septoria tritici nur durchschnittlich. Zu beachten ist die zum Teil schlechte Verträglichkeit des Herbizides Broadway.
Wintersonne (Südwestdeutsche Saatzucht/Saaten-Union)
Wintersonne schnitt am Standort Giebelstadt ertraglich erneut überdurchschnittlich ab und liegt auch überregional und mehrjährig an der Spitze des Sortiments. Die Sorte ist sowohl bei den Resistenzeigenschaften als auch in allen Qualitätskriterien vergleichbar mit Wintergold, lediglich im Rohproteingehalt etwas schlechter. Zu beachten ist die schwächere Winterfestigkeit.
Sambadur (Saatzucht Donau/Hauptsaaten)
Sambadur schwankt ertraglich um das Mittel des Sortiments. In der Qualität ist die Sorte etwas schlechter als Wintergold und Wintersonne. Sambadur ist überdurchschnittlich standfest und bei der Resistenz gegen Fusarium schlechter, gegen Mehltau aber besser eingestuft als die beiden anderen Sorten.

![]() 52 KB
52 KB
![]() 24 KB
24 KB