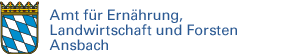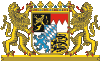Sortenempfehlungen Wintertriticale und Winterroggen Herbst 2025

Kulturen passen auf viele Standorte
Viele überwiegend leichte Standorte im fränkischen Trockengebiet sind für Wintertriticale oder -roggen wesentlich besser geeignet als für Winterweizen. Während der Triticale fast ausschließlich als Kraftfutter in der tierischen Veredelung dient, kann Roggen sowohl als Brot-, zunehmend aber auch als Futtergetreide in der Schweinemast verwendet werden.
In Mittelfranken stehen zwei Landessortenversuche zum Wintertriticale, nämlich in Großbreitenbronn und in Bieswang, sowie ein Landessortenversuch zum Winterroggen in Großbreitenbronn.
Wintertriticale:
Der Versuch am Standort Großbreitenbronn (leichte bis mittlere Keuperlage, Nähe Triesdorf) wurde nach Vorfrucht Silomais am 8.10.2024 pfluglos gesät und lief rasch und gleichmäßig auf. Die Herbstentwicklung war normal. Nach dem Winter, den die Pflanzen schadlos überstanden, verhinderte die extreme Trockenheit eine normale Bestockung, so dass der Bestand sehr dünn blieb. Gleichzeitig konnten sich aber auch keine Pilzkrankheiten entwickeln. Bis zum Ährenschieben war praktisch kein bonitierbarer Befall vorhanden. Die in Stufe 2 erst kurz vor der Blüte durchgeführte Fungizidmaßnahme stellte daher, ebenso wie der einmalig applizierte Wachstumsregler, lediglich eine Versicherungsmaßnahme dar. Lager trat auch in der unbehandelten Stufe 1 nicht auf. Die Abreife verlief aufgrund der Trockenheit und hoher Temperaturen sehr rasch.
Die Ernte erfolge am 11.7.2025. Der Versuch erbrachte in der unbehandelten Stufe 1 einen Durchschnittsertrag von 70,2 dt/ha. Die je einmal mit Wachstumsreglern und einem Fungizid behandelte Stufe 2 brachte es auf 72,0 dt/ha, womit das langjährige Ertragsmittel dieses Standortes um 17 dt/ha unterschritten wurde. Ertragsbegrenzend wirkte in erster Linie sicherlich der extreme Wassermangel während des gesamten Frühjahrs und Frühsommers, zusätzlich aber vermutlich auch die aufgrund der Lage der Versuchsfläche im „Roten Gebiet“ um 20 % reduzierte Stickstoffdüngung. Der Mehraufwand in Stufe 2 konnte nicht durch den zusätzlich erzielten Ertrag gedeckt werden und führte zu einem Mindererlös von 58 €/ha.
Am Standort Bieswang (auf dem Jura, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) wurde der Versuch am 18.10.2024 nach Vorfrucht Futtererbse in ein gepflügtes Saatbett gesät und entwickelte sich gut. Im Frühjahr präsentierte sich ein normaler Bestand. Auf dem besseren Boden genügte die Wasserversorgung für eine durchschnittliche Bestockung, so dass der Versuch eine gute Bestandesdichte als Grundlage für einen hohen Ertrag aufwies. An Blattkrankheiten spielten neben Braunrost vor allem Mehltau und Rhynchosporium eine Rolle, welche in Stufe 2 mit einer einmaligen Fungizidmaßnahme sicher bekämpft werden konnten. Lager trat weder in der einmalig mit einem Wachstumsregler behandelten Stufe 2 noch in der unbehandelten Stufe 1 auf.
Der Versuch wurde am 8.8.2025 geerntet. Aufgrund der vorangegangenen ausgeprägten Regenphase waren Korn und Stroh von Schwärzepilzen besiedelt. Die Mehrzahl der Sorten wies am Erntegut optisch deutlich erkennbaren Auswuchs auf. Mit hervorragenden 104,0 dt/ha in der Stufe 1 und 109,2 dt/ha in der intensiver geführten Stufe 2 erzielte der Standort ein respektables Ergebnis. Der erhöhte Aufwand in Stufe 2 führte zu einem Mindererlös von 8 €/ha.
Folgende Sorten werden zum Anbau in Mittelfranken empfohlen:
Die ab heuer nur noch im Anbaugebiet „Jura/Hügelland“ (AG 23) empfohlene Sorte schneidet sowohl am Versuchsstandort Bieswang als auch überregional und mehrjährig in der extensiv geführten Stufe 1 ertraglich wesentlich schlechter ab als in der mit Wachstumsreglern und Fungiziden behandelten Stufe 2. Darin spiegelt sich ihre hohe Anfälligkeit für Braun- und auch für Gelbrost wider. In der intensiven Behandlungsstufe liegt sie ertraglich überregional mehrjährig leicht über dem Durchschnitt des Sortiments. Lombardo ist nur durchschnittlich standfest. Größtes Manko aber ist die ebenfalls nur durchschnittlich eingestufte Fusarium-Resistenz, weshalb nach Mais eine Pflugfurche und gegebenenfalls eine gezielte Fusarium-Spritzung in der Blüte zu empfehlen sind.
Cedrico fiel heuer in beiden Anbaugebieten ertraglich etwas ab, kann sich aber mehrjährig noch im Durchschnitt des Sortiments halten. Die standfeste Sorte zeichnet sich insbesondere durch ihre gute Resistenz gegen Fusarium aus. Einzige Schwachstelle ist die leicht erhöhte Anfälligkeit für Mehltau, die in der Bestandesführung zu beachten ist. Cedrico eignet sich von allen empfohlenen Sorten am ehesten zum pfluglosen Anbau nach Mais.
Auch bei Ramdam gilt die Empfehlung ab heuer nur noch für das Anbaugebiet „Jura/Hügelland“ (AG 23), wo er aber ertraglich inzwischen auch nicht mehr ganz mit den anderen empfohlenen Sorten mithalten kann. Die Sorte ist im Wuchs deutlich länger und weist daher eine nur durchschnittliche Standfestigkeit auf. Ihre Blattgesundheit ist durchwegs gut, bei Braunrost sogar gut bis sehr gut. Allerdings ist Ramdam gegen Fusarium nur durchschnittlich resistent.
Rivolt fiel heuer am Versuchsstandort Großbreitenbronn ertraglich etwas ab, zählt aber in beiden Anbaugebieten sowohl ein- als auch mehrjährig zu den ertragsstärksten Sorten. Die Standfestigkeit ist gut durchschnittlich. Rivolt ist recht blattgesund, zeigt aber bei Gelbrost eine Schwäche. Positiv ist seine unterdurchschnittliche Anfälligkeit für Fusarium.
Trias steht nur im Anbaugebiet „Fränkische Platten“ (AG 21) neu in der Empfehlung, da er hier am Versuchsstandort Großbreitenbronn wiederholt sehr hohe Kornerträge lieferte. Heuer fiel er ertraglich etwas ab, liegt aber überregional mehrjährig immer noch leicht über dem Durchschnitt des Sortiments. Er ist gut durchschnittlich standfest und gegen die meisten Blattkrankheiten, vor allem gegen Gelbrost, überdurchschnittlich resistent. Zu beachten ist jedoch die nur durchschnittliche Resistenz gegen Fusarium, weshalb die Sorte weniger zum pfluglosen Anbau nach Mais geeignet ist. Die Empfehlung zur Saatstärke liegt laut Züchter bei 280-400 Körnern/m².
Auch bei Fantastico ist die Anbauempfehlung auf das Anbaugebiet „Fränkische Platten“ (AG 21) beschränkt, wo er heuer am Versuchsstandort Großbreitenbronn erneut sehr gut abschnitt. Überregional liegt er mehrjährig gleichauf mit Trias. Die Sorte zählt zu den kurzen Typen, woraus auch die gute Standfestigkeit resultiert. Hervorzuheben sind die geringen Anfälligkeiten für Rhynchosporium und Braunrost sowie die überdurchschnittliche Resistenz gegen Fusarium. Die Resistenz gegen Gelbrost ist aber nur durchschnittlich. Der Züchter empfiehlt als Saatstärke 280-400 Körner/m².
Sortenspezifische Anbauhinweise (z. B. zur Saatstärke) zu den schon länger empfohlenen Wintertriticale-Sorten stehen im aktuellen Versuchsberichtsheft „Integrierter Pflanzenbau“ („Grünes Heft“) auf Seite 49.
Weitergehende Informationen zu den empfohlenen Wintertriticale-Sorten 2025 finden Sie hier ![]() 32 KB
32 KB
Die ausführlichen Versuchsergebnisse aus den Landessortenversuchen, die Sortenbeschreibung sowie weitere Informationen finden Sie bei der LfL:
Winterroggen:
Der Versuch stand in Großbreitenbronn auf dem gleichen Schlag wie der LSV Wintertriticale und wurde auch am gleichen Tag gesät. Die Entwicklung verlief analog zum Triticale. Im Roggen trat jedoch schon früh erster Befall mit Braunrost auf, so dass in Stufe 2 eine Fungizid-Vorlage nötig wurde. Später erfolgte noch eine Abschlussbehandlung. Aufgrund des sehr trockenen Frühjahrs blieben die Pflanzen recht kurz, so dass bereits die in Stufe 1 mit reduzierter Aufwandmenge durchgeführte Wachstumsregler-Behandlung genügte, um Lager zu vermeiden. Der Bestand reifte im heißen Juni schnell, jedoch etwas ungleichmäßig ab.
Bei der Ernte am 11.7.2025 wurde sowohl in Stufe 1 mit durchschnittlich 59,9 dt/ha, als auch in der mit höheren Mengen von Wachstumsreglern und zweimalig mit Fungiziden behandelten Stufe 2 mit 67,2 dt/ha ein enttäuschend niedriger Ertrag erzielt. Der langjährige Mittelwert dieses Standortes wurde um sage und schreibe 26 dt/ha unterschritten, was das schlechteste Ergebnis seit über 15 Jahren bedeutet. Dies dürfte bei der an sich sehr trockenheitstoleranten Kultur Winterroggen kaum allein mit dem extremen Wassermangel während des gesamten Frühjahrs und Frühsommers zu erklären sein. Wahrscheinlich trug auch die aufgrund der Lage der Versuchsfläche im „Roten Gebiet“ um 20 % reduzierte Stickstoffdüngung ihren Teil zum schlechten Versuchsergebnis bei. Nach Deckung der Kosten für den höheren Pflanzenschutzaufwand in Stufe 2 verblieb noch ein Mehrerlös von 26 €/ha.
Folgende Sorten werden zum Anbau in Mittelfranken empfohlen:
Die Hybridsorte konnte heuer am Standort Großbreitenbronn ihr sehr gutes Ertragsergebnis aus dem letzten Jahr nicht ganz bestätigen. Überregional und auch mehrjährig liegt sie im Durchschnitt des Sortiments. Die Resistenz gegen Rhynchosporium ist über-, jene gegen Braunrost aber unterdurchschnittlich. Bei der Anfälligkeit für Mutterkorn verfügt KWS Serafino über eine gute Einstufung. Diese ist vor dem Hintergrund der zum 1. Juli 2025 erfolgten Absenkung des Höchstgehaltes für Mutterkorn-Sklerotien in unverarbeitetem Roggen von einst 0,5 auf jetzt nur noch 0,2 g/kg mit entscheidend für eine weitere Anbau-Empfehlung. Die Standfestigkeit ist nur knapp durchschnittlich und die Fallzahl hoch bis sehr hoch.
Die zweite empfohlene Hybridsorte schneidet sowohl am Standort Großbreitenbronn als auch überregional und mehrjährig deutlich schwächer ab als KWS Serafino. Sie zählt damit zu den ertragsschwächeren Sorten unter den Hybriden. Angesichts der schon genannten Absenkung des Höchstgehaltes für Mutterkorn-Sklerotien rückt jedoch die Einstufung beim Mutterkornbefall an die erste Stelle der Auswahlkriterien zur Sortenwahl. KWS Tutor ist genauso standfest, aber etwas kürzer als KWS Serafino, hat die gleichen Einstufungen bei Rhynchosporium und Braunrost und weist eine geringere Fallzahl auf.
SU Bebop liegt auf einem für eine Populationssorte akzeptablen Ertragsniveau, jedoch deutlich unter den Hybridsorten. Er ist relativ langstrohig mit nur knapp durchschnittlicher Standfestigkeit, aber leicht überdurchschnittlicher Fallzahl. Gegen Braunrost ist er gut durchschnittlich resistent. Er ist wenig anfällig für Mutterkorn.
Sortenspezifische Anbauhinweise (z. B. zur Saatstärke) zu den schon länger empfohlenen Winterroggen-Sorten stehen im aktuellen Versuchsberichtsheft „Integrierter Pflanzenbau“ („Grünes Heft“) auf Seite 40.
Weitergehende Informationen zu den empfohlenen Winterroggen-Sorten 2025 finden Sie hier ![]() 24 KB
24 KB
Die ausführlichen Versuchsergebnisse aus den Landessortenversuchen, die Sortenbeschreibung sowie weitere Informationen finden Sie bei der LfL: