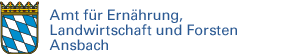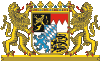Brot aus Luft oder:
Was hat das Haber-Bosch-Verfahren mit dem Ukrainekrieg zu tun?
Festrede von Wolfgang Kerwagen, Behördenleiter des AELF Ansbach, anlässlich der Schulschlussfeier der Landwirtschaftsschule Ansbach am 1. April 2022
Der Beginn des Ukrainekrieges am 24. Februar 2022 markiert nach Ansicht vieler Politiker einen Wendepunkt. Ist es auch ein Wendepunkt für die Landwirtschaft? Der Beitrag von Wolfgang Kerwagen, Behördenleiter am AELF Ansbach, wirft einen Blick auf die Geschichte der industriellen Agrarchemie in Deutschland. Er zeigt vielfältige Zusammenhänge sowie Parallelen zum Ukrainekrieg auf und liefert Denkanstöße zu den großen und komplexen agrar-, ernährungs- und energiepolitischen Herausforderungen unserer Zeit.
Zur Entwicklung der industriellen Agrarchemie in Deutschland
Seit Mitte des 19. Jahrhunderts ist durch Justus von Liebig bekannt, dass Stickstoff die Grundlage für das Wachstum von Nutzpflanzen ist. Dem Ackerboden wurden früher die notwendigen Stickstoffverbindungen durch Mist, Kompost, die Fruchtfolge mit Leguminosen oder weitere „natürliche Dünger“ wie Guano und Chilesalpeter zugeführt.
Durch das rasante Anwachsen der Weltbevölkerung im 19. Jahrhundert konnte der große Bedarf an Stickstoffverbindungen nicht mehr durch natürliche Düngervorkommen gedeckt werden. Darüber hielt der britische Chemiker William Crookes 1898 eine in der Wissenschaft viel beachtete Rede, worin er darlegte, dass bis zum Jahr 1918 die Nachfrage nach Stickstoffverbindungen das Angebot bei weitem übersteigen werde und der westlichen Welt eine Hungersnot ungeahnten Ausmaßes drohe. Die einzige Lösung läge in der chemischen Fixierung des in der Luft enthaltenen Stickstoffs. Der Versuch der Bindung des Luftstickstoffs in einer von Pflanzen aufnahmefähigen Chemikalie entwickelte sich in der Folge zu einem Schwerpunkt der chemischen Forschung. Er wurde unter dem Titel „Brot aus Luft“ bekannt.
Ab 1904 beschäftigte sich der deutsche Chemie-Professor Fritz Haber mit den chemischen Grundlagen der Ammoniak-Synthese. Ein von ihm entwickeltes Verfahren erlangte 1911 den Patentschutz. Für seine Arbeiten erhielt Haber 1918 den Nobelpreis für Chemie. Bei der technischen Umsetzung arbeitete Haber mit BASF zusammen und überließ BASF später auch das Patent zur wirtschaftlichen Nutzung. Die großtechnische Umsetzung der Ammoniak-Produktion gelang erst durch die Zusammenarbeit mit Carl Bosch, dem langjährigen Vorstandsvorsitzenden der BASF und später der IG Farben. Bosch entwickelte das Haber-Bosch-Verfahren zur technischen Reife und erhielt 1931 dafür den Nobelpreis für Chemie. Bosch gründete 1914 auch die landwirtschaftliche Versuchsstation Limburgerhof. Die dort durchgeführten Düngungsversuche markieren den Beginn der industriellen Agrarchemie in Deutschland.
Kriegs- und Siegeszug des Haber-Bosch-Verfahrens
Getrieben und finanziert wurde die Verfahrensentwicklung durch das deutsche Kriegsministerium. Bosch gab diesem bei Ausbruch des ersten Weltkriegs das sogenannten Salpeter-Versprechen, einen Vertrag über die Lieferung großer Mengen Salpetersäure, dem Grundbaustein für Sprengstoff. Aufgrund der Seeblockade der Engländer gelangte kein Chilesalpeter mehr nach Deutschland. Carl Bosch sicherte zu, dass über das Haber-Bosch-Verfahren ausreichende Mengen von Salpetersäure bzw. einem Folgeprodukt Ammoniumnitrat geliefert würde. Er hielt sein Versprechen und leistete damit einen Beitrag zum 1. und 2. Weltkrieg mit all seinen verheerenden Folgen. Ein wesentliches Ziel des Russlandfeldzuges von Hitler war die Eroberung der Kornkammer Europas, der Ukraine.
Carl Bosch verfiel nicht zuletzt wegen der politischen Entwicklungen im Hitler-Deutschland in tiefe Depressionen. Er wurde 1935 von den Nazis als Vorstandsvorsitzender der IG Farben abgesetzt, beging 1939 einen Selbstmordversuch und starb ein Jahr später in Heidelberg.
Der Aufstieg von BASF zu einer der weltweit führenden Firmen der Agrochemie ist eng mit dem Haber-Bosch-Verfahren verbunden. 1919 machte die Ammoniak-Produktion 59% des Umsatzes aus. Nach dem 2. Weltkrieg musste BASF das Patent an die Alliierten abtreten. Das Haber-Bosch-Verfahren trat seinen Siegeszug um die ganze Welt an.
Dünger- und Sprengstoff-Herstellung mittels Haber-Bosch-Verfahren
Ausgangsstoffe des Haber-Bosch-Verfahrens sind Wasserstoff, der heute überwiegend über Erdgas gewonnen wird, sowie Stickstoff aus der Luft. Es entsteht Ammoniak, der zu 80% zu wichtigen Mineraldüngern wie Ammoniumnitrat und Harnstoff weiterverarbeitet wird. 5% des Ammoniaks gehen in die Sprengstoffherstellung. Zur Erinnerung: Am 04.08.2020 explodierten 2750 Tonnen Ammoniumnitrat im Hafen von Beirut. 207 Menschen wurden getötet und 300.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Doch schon 1921 kam es zu einer verheerenden Explosion im BASF-Werk Ludwigshafen-Oppau. Damals verloren 599 Menschen ihr Leben, weitere 1977 wurden verletzt.
Es ist kein Wunder, dass die Düngemittelwerke heute vor allem dort angesiedelt sind, wo es günstiges Erdgas gibt – z. B. Russland, Ukraine. Der größte Einzelabnehmer für Erdgas in Deutschland ist die Firma BASF. Sie ist über ihre Tochterfirma Wintershall nach Gazprom zweitgrößter Anteilseigner an Nordstream.
Die Welt-Jahresproduktion von Ammoniak nach dem Haber-Bosch-Verfahren betrug 2017 etwa 150 Millionen Tonnen mit China, Indien und Russland als größten Produzenten. Aufgrund des hohen Energiebedarfs bei der Herstellung des benötigten reinen Wasserstoffs entfallen etwa 1,4 Prozent des Weltenergiebedarfs auf das Haber-Bosch-Verfahren. Die dabei erzeugten CO2-Emissionen betragen etwa drei bis fünf Prozent des globalen Ausstoßes. Heutzutage haben, zumindest bei der Bevölkerung der Industrienationen, etwa 40 Prozent des im menschlichen Körper enthaltenen Stickstoffs schon einmal an der Haber-Bosch-Synthese teilgenommen. Würde man ein Zeitdiagramm für die Ammoniakproduktion, die Entwicklung der Weltbevölkerung und dem Ausstoß schädlicher Klimagase wie CO2 erstellen, sie hätten wahrscheinlich den gleichen Verlauf.
Zur Gegenwart - zum Ukrainekrieg
Der von Putin vom Zaun gebrochene Krieg markiert eine Zeitenwende hinsichtlich der Verteidigungs-, der Energie- und auch der Ernährungspolitik. Putin denkt und handelt geopolitisch. Nach dem Aufstieg zum wichtigsten Energielieferanten der Welt geht es nun um den Zugriff auf die Kornkammer Europas, der Ukraine.
Der Ukrainekrieg macht uns bewusst, dass unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft, unsere Landwirtschaft in starkem Maß auf dem Verbrauch fossiler Energie aufbaut. Die negativen Begleiterscheinungen (Klimawandel) werden leider immer noch zu häufig ausgeblendet. Die Abhängigkeit von günstigem Erdöl/ Erdgas, günstigem Dünger - und damit von Russland - wird im Moment sehr deutlich. Wir waren sehr naiv.
Bereits von 125 Jahren herrschte die Sorge vor einer großen Hungersnot. Herstellung und Verwendung von Mineraldünger leisten einen wesentlichen Beitrag, um heute fast 8 Milliarden Menschen zu ernähren. Bezogen auf die deutsche Landwirtschaft beträgt der Stickstoffeinsatz knapp 3 Mio Tonnen. Etwa die Hälfte des stickstoffbasierten Düngemitteleinsatzes stammt aus Mineraldünger, die andere Hälfte stammt aus Gülle, Mist und Gärresten. Derzeit werden etwa 20 Prozent des Stickstoff-Mineraldüngers der EU importiert, bisher v. a. aus Russland und Kasachstan.
Folgt auf die Gas- die Stickstoffkrise? Wird Dünger zum unbezahlbaren Gut? Die drohende Gas-Krise könnte für Düngemittelproduzenten zum Problem werden – und damit erst recht für Landwirte.
Wie sehr die Hersteller am Gas-Tropf hängen, haben bereits die vergangenen Monate gezeigt: Nachdem im März die Gaspreise stiegen, drosselten die großen Hersteller wie BASF, Yara und SKW Piesteritz schlagartig ihre Produktion. Rund 1/3 des hiesigen Stickdorfbedarfes decken diese ab. Die Folgen bekam bundesweit jeder zu spüren, der Dünger kaufen wollte: Für Kalkammonsalpeter verlangten die Händler im Vergleich zum Vorjahr teilweise das Dreifache, Harnstoff und AHL sind etwa doppelt so teuer und obschon Dünger für die Nahrungsmittelproduktion unerlässlich ist, dürften die Düngerproduzenten bei einer Rationierung der Gasversorgung auf keine Milde hoffen. Davon geht der agrarfax Marktanalayst Jan Peters aus Brunsbüttel aus. Ähnlich stuft auch die BASF die Lage ein und hat bereits angekündigt, womöglich die Stickstoffdüngerproduktion einstellen zu müssen.
Blick in die Zukunft
Können wir auf Mineraldünger verzichten? Kurzfristig und global wohl nicht. Wasserstoff als Ausgangsstoff des Haber-Bosch-Verfahrens könnte auch mit Windenergie klimaneutral erzeugt werden. Die ersten Anlagen dazu gibt es. Die Wasserstofftechnologie wird die Schlüsseltechnologie der Zukunft, denn sie soll fossile Energie in vielen Bereichen ersetzen. Sie hat aber zur Folge, dass der Strombedarf enorm ansteigen wird. Der Ausbau der erneuerbaren Energien wird rasant zulegen müssen. Dies darf aber nicht auf Kosten der Ernährungssicherheit gehen. Bei Fotovoltaik müssen zunächst alle bereits versiegelten Flächen (Dächer, Parkflächen, Autobahnen) in Anspruch genommen werden und für landwirtschaftliche Flächen sollten Agri-PV-Anlagen den Vorzug vor Freiflächenanlagen haben. Der Flächenverbrauch von aktuell täglich 11 ha LF (ohne Ausgleichsflächen) in Bayern muss reduziert werden. Flächen dürfen nur in Anspruch genommen werden, wenn es im Innenbereich keine Möglichkeit mehr gibt und bestehende Industriebrachen reaktiviert sind.
Die Transformation in eine klimaneutrale Gesellschaft werden wir aber nicht schaffen, wenn wir unseren westlichen Lebensstil, unser Konsumverhalten nicht kritisch hinterfragen. Nachhaltiges Wirtschaften und Denken in Kreisläufen beginnt im eigenen Haushalt. Dieses Grundwissen vermittelt die Hauswirtschaftsschule und sollte verpflichtend eingeführt werden.
Ökologische Kreislaufwirtschaft in der Landwirtschaft geht nicht ohne Tierhaltung. Daran sollte man denken, wenn einseitig Fleischverzicht gepredigt wird.
Die Vergangenheit lehrt uns aber auch, nicht allzu technikgläubig zu sein. Wir sind Teil des Ökosystems Erde. Wenn wir dieses vernichten, vernichten wir unsere Lebensgrundlage. Ich sage das deshalb so deutlich, weil bei der berechtigten Diskussion um eine sichere Lebensmittelversorgung die grüne Agrarpolitik in Frage gestellt wird. Insektenschutz ist mindestens genauso wichtig wie Klima- und Energiepolitik. Die Frage des Klimaschutzes entscheidet darüber, wie lange wir auf diesem Planeten überleben. Die Frage der Artenvielfalt entscheidet darüber, ob wir überleben. Wir müssen alles im Blick behalten, um nicht die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen.
Der Landwirt der Zukunft muss alles können. Er muss die Lebensmittelerzeugung sichern, Energie erzeugen, das Klima, die Umwelt und die Natur schützen. Landwirtschaft war noch nie so wichtig wie heute!